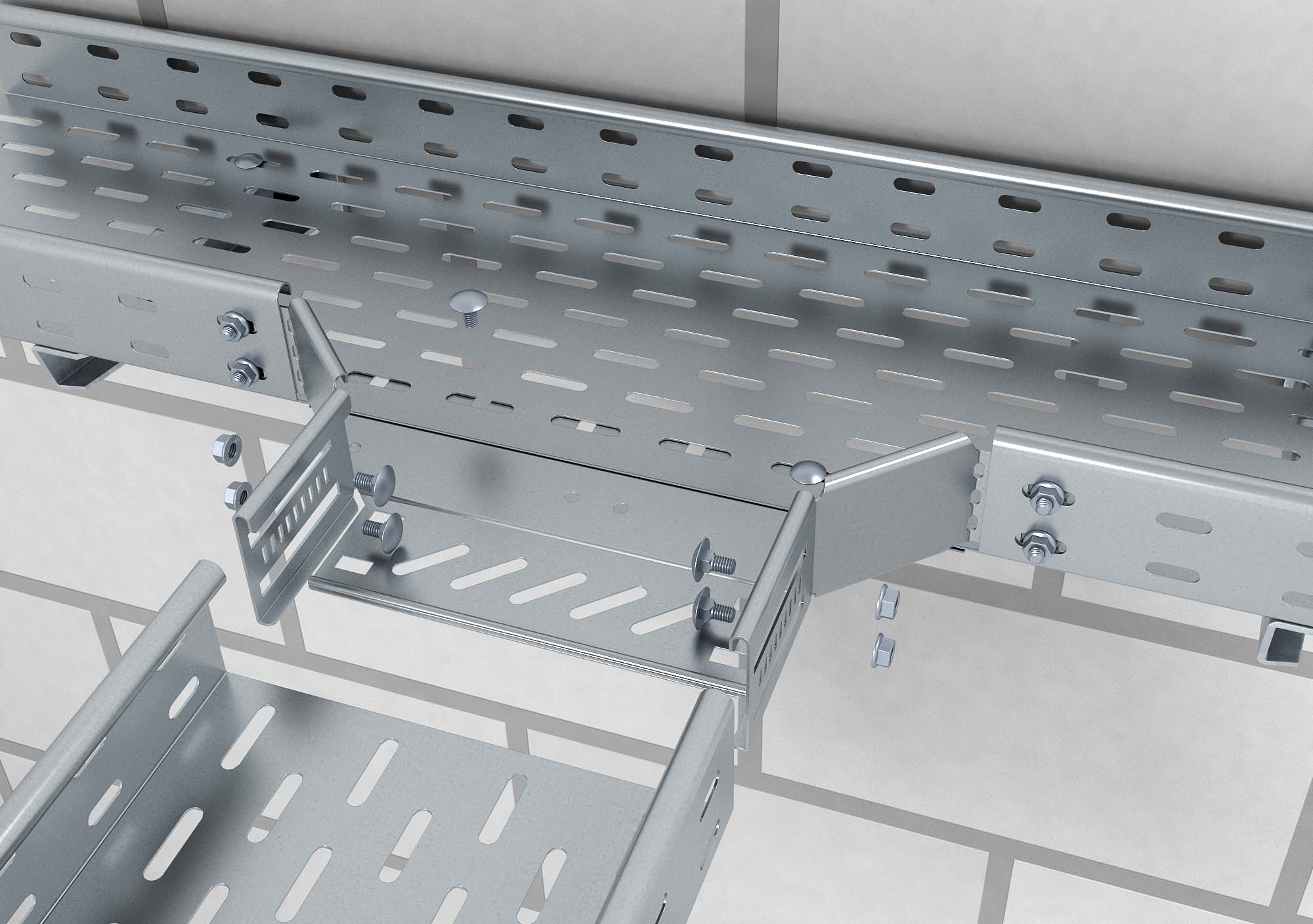Prozessoptimierungen
Schwachstellen nicht-digitalisierter Messdienstleister
KMUs prägen die Branche der Messdienstleister. Sie haben den Vorteil, dass sie meist schlankere Verwaltungsstrukturen haben als große Konzerne. Auf der anderen Seite scheuen sie Investitionen in die Digitalisierung ihrer Prozesse. Denn neue Softwarelösungen oder der Kauf von fernauslesbaren Geräten – etwa für Automated Meter Reading – fordern zunächst Investitionen. Die Effekte werden aber erst mittelfristig sichtbar. Die Folge: Papier ist in fast allen Bereichen das Kommunikationsmittel Nummer Eins.
Schließlich kostet ein Karton mit hunderten Blatt Papier nur ein paar Euro und Unternehmen müssen Mitarbeitende nicht extra schulen. Und bei den Messgeräten sind häufig noch Walk-by-Lösungen der Standard anstatt einer komplett digitalen Zählerfernauslesung. Eine Politik der zurückhaltenden Digitalisierung mindert die Produktivität und lähmt die Prozesse vom Auftragseingang bis zur -abwicklung. Außerdem macht die novellierte EU-Energieeffizienz-Richtlinie (EED) die Umstellung auf fernauslesbare Technik in verschiedenen Stufen zur Pflicht. Mirko Helbig, Koordinator Regionalvertrieb D-A-CH bei Qundis, beschreibt, wo seiner Meinung nach die aktuell fünf größten Schwachstellen liegen, und gibt Ratschläge, wie Unternehmen der Branche ihre Prozesse digitalisieren und wirtschaftlicher gestalten können.
1. Prozess der Auftragsabwicklung
In vielen Betrieben im Bereich der Messdienstleistungen sieht der nicht-digitalisierte Prozess der Auftragsabwicklung so aus: Der Kunde ruft an, der Auftrag wird im System erfasst und ausgedruckt. Der Monteur geht in das Büro, nimmt das Blatt Papier aus seinem Postkasten und schreibt vor Ort alles mit Kugelschreiber auf. Das Ganze geht dann oft per Post wieder an den Innendienst, der die Daten vom Papier ins System überträgt. Dass dieser Prozess zu aufwendig und ineffizient ist, sollte schnell klar sein. Dennoch ist es oft gelebte Praxis und Alltag in vielen KMUs der Branche. Dabei könnte es mit moderner Technologie wesentlich einfacher sein. Dann sähe das Ganze so aus: Der Innendienst legt den Auftrag in einer Verwaltungssoftware wie z.B. der Smart Administration Software (Q SAM) von Qundis ab. Dank fernauslesbarer Geräte können die Daten monatlich aus dem Büro erfasst werden. So können sich die Monteure auf ihr Kerngeschäft fokussieren: die Installation und Inbetriebnahme von Messgeräten und Auslesetechnik. Solche Aufträge würde die Software automatisiert einem Monteur und einer Tour zuweisen. Dieser hat sein Tablet dabei, das sich alle 15 Minuten aktualisiert. Er muss dazu nicht zur Zentrale fahren und sein Postfach prüfen. Fahrzeiten für die Abholung von Auftragsunterlagen, Postversand und Papierverwaltung entfallen komplett. Erleben Sie Licht in neuer, farbiger Vielfalt. Mit dem DALI Gateway Colour für KNX steuern Sie DALI-Leuchten zentral und flexibel, individuell und vielseitig, um das Wohlbefinden gezielt zu steigern und eine besondere Atmosphäre zu schaffen. ‣ weiterlesen
Intelligentes Lichtmanagement.
2. Qualität der Daten
Die manuelle Erfassung der Daten auf Papier verlangsamt nicht nur den Prozess an sich. Es macht den Ablauf auch anfälliger für Fehler. Ein durchschnittlicher Monteur hat im Schnitt circa 80 Heizkörper, deren Daten er pro Tag erfasst. Dabei können natürlich Fehler auftreten. Denn zunächst gelangt das Papier in den Innendienst, der die Daten überträgt – wieder eine Fehlerquelle, schließlich ist nicht jede Handschrift klar und sauber und auch beim Übertragen an sich können sich Fehler einschleichen. Stimmt etwas nicht, wird das aber meist erst dann deutlich, wenn die Richtigkeit von externen Dienstleistern geprüft wird. Und dann beginnt die Fehlersuche. Eine Digitalisierung der Datenerfassung kann die Fehler nicht auf null reduzieren, aber sie kann die Fehlerquellen minimieren und die Zeit, bis der Fehler erkannt wird, reduzieren. Von der App würden die Daten direkt in das System gelangen, das bereits erste Fehler erkennen kann.
3. Ungleichmäßige Auslastung
Durch eine ausgebliebende Digitalisierung bündelt sich bei vielen Messdienstleistern die große Last auf rund fünf Monate im Jahr. Meist fallen die einmal jährlich stattfindenden Zählerstanderfassungen auf den Januar oder Februar. Dann herrscht Hochbetrieb. Bei tausenden Geräten in der Betreuung müssen hier nun die Daten erfasst und übertragen werden, damit die Mieter rechtzeitig ihre Abrechnungen erhalten. Der Stress verstärkt sich, weil zu diesem Zeitpunkt dann erstmals bestehende Gerätemängel festgestellt und behoben werden müssen. Mit klug eingerichteten Gateways und Geräten, die aus der Ferne ausgelesen werden können, ist es allerdings möglich, die Daten monatlich zu erfassen und auszuwerten. Das heißt: Eine Verbrauchserfassung und -abrechnung ist ganzjährlich möglich. Eventuelle Probleme können also bereits im Mai oder Juni erkannt und behoben werden. Eine Digitalisierung kann zwar auch Fehler nicht zu 100 Prozent eliminieren, sorgt aber dafür, dass die Auslastung besser verteilt ist.