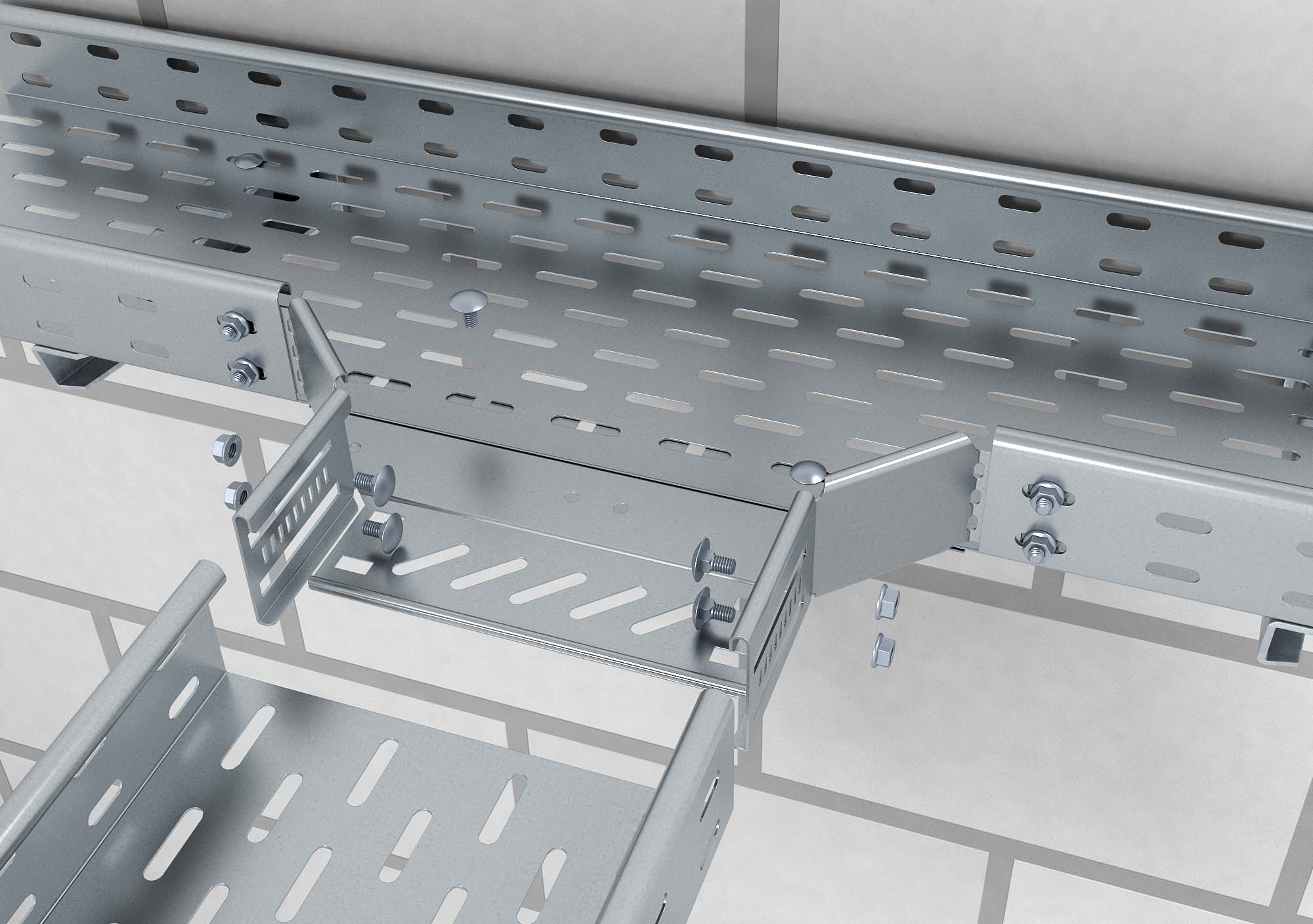Die Photovoltaik-Stromerzeugung ist einer der Grundpfeiler der Energiewende. Nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller beteiligten Gewerke lassen sich die hoch gesteckten Klimaschutzziele erreichen und die ab nächstem Jahr geltende PV-Pflicht bei grundlegenden Dachsanierungen in der Fläche umsetzen. Aus diesem Grund haben der Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Baden-Württemberg und der Fachverband für Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg gemeinsam einen Informationsleitfaden erarbeitet, der Innungsfachbetrieben am Beispiel von zwei musterhaften Kundenprozessen aufzeigen soll, wie gewerkeübergreifende Photovoltaik-Kooperationen in der Praxis idealtypisch umgesetzt werden können.
„Grundsätzlich ist unerheblich, ob der Kunde seine Anfrage bei einem Elektro-Innungsfachbetrieb stellt oder diese über einen Dachdecker-Innungsfachbetrieb angenommen wird. Entscheidend ist, dass die beteiligten Gewerke gemeinsam eine für den Kunden passende Lösung erarbeiten und anbieten“, erklärt Thomas Bürkle, Präsident des Fachverbands für Elektro- und Informationstechnik BW. Zwischen Dachdecker- und Elektrohandwerk gäbe es in der Praxis einige komplexe Schnittstellen zu meistern, die eng abgestimmt werden müssten, um einen möglichst effizienten Kundenprozess im Sinne eines One-Stop-Shops abbilden zu können. Dabei sind die individuellen Kundenbedürfnisse je nach Nutzerverhalten zu berücksichtigen und eine möglichst hohe Eigenverbrauchsquote anzustreben, um unabhängiger von externen Energielieferungen zu werden und damit auch einen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leisten.
Karl-Heinz Krawczyk, Landesinnungsmeister des Dachdeckerinnungsverbands BW ergänzt: „Für eine schnelle und hochwertige Umsetzung sind professionelle Handwerker-Kooperationen gefragter denn je. Wenn die Kooperation zwischen den Gewerken partnerschaftlich umgesetzt wird, werden Dachmontage und Anlageninstallation aufeinander abgestimmt und dabei insbesondere die Montagesysteme, Dachdurchführungen und der Anschluss an die Gebäudeenergieversorgung professionell, regelkonform ausgeführt“. Erleben Sie Licht in neuer, farbiger Vielfalt. Mit dem DALI Gateway Colour für KNX steuern Sie DALI-Leuchten zentral und flexibel, individuell und vielseitig, um das Wohlbefinden gezielt zu steigern und eine besondere Atmosphäre zu schaffen. ‣ weiterlesen
Intelligentes Lichtmanagement.
Bürkle und Krawczyk betonen abschließend: Um einen zuverlässigen, störungsfreien Betrieb über die Laufzeit von mehr als 20 Jahren zu gewährleisten, müssen für Ausführung und Wartung höchste Qualitätsansprüche gelten und die Gewerke-Schnittstellen zwischen Dachdecker- und Elektrohandwerk fachkundig koordiniert werden. Dabei muss die vorhandene Gebäudeelektrotechnik bei der Anlagenplanung und -dimensionierung sowie der adäquate Anschluss ans Verteilnetz der Energieversorger ebenso berücksichtigt werden, wie das gesamte Dachschichtenpaket. Wenn bei diesen Maßnahmen am Dach zugleich auf ein intelligentes Feuchtigkeitsmonitoringsystem gesetzt und somit eine vorausschauende Dachbewirtschaftung möglich wird, lässt sich die Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz im Gebäudesektor insgesamt nochmals erhöhen.
Der Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg ist die Dachorganisation der 37 Elektro- bzw. Informationstechniker-Innungen im Land und vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die Interessen von rund 7.500 Handwerksunternehmen der Elektrotechnik, der Informationstechnik und des Elektromaschinenbaus. Die gut 60.000 Beschäftigten der Branche erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von knapp acht Milliarden Euro. Rund 5.500 junge Menschen werden derzeit in einem der fünf attraktiven Ausbildungsberufe zum Facharbeiter ausgebildet. Weitere Informationen über das baden-württembergische Elektrohandwerk finden Sie unter www.fv-eit-bw.de.